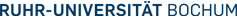Vom Boom zur Krise: Der deutsche Steinkohlenbergbau nach 1945
Der Steinkohlenbergbau nach 1945 war und ist durch tiefgreifende strukturelle, ökonomische, technische, soziale und auch kulturelle Umbrüche und Transformationen geprägt, die durch je vier Projekte in den Themenlinien Innovationskulturen im Wandel nach 1945 und Transformation von Industrielandschaften erforscht werden. Projektträger ist das Deutsche Bergbaumuseum.
In der Themenlinie Innovationskulturen im Wandel nach 1945 (Projektleitung: Dr. Lars Bluma ) werden die bergbauspezifischen Innovationsleistungen in den Feldern Technik, Wissenschaft und Unternehmensorganisation/-strategie untersucht. Zentrale These ist, dass der Steinkohlenbergbau eine eigene Innovationskultur hervorbrachte, die eng mit den ökonomischen, sozialen und politischen Rahmenbedingungen verknüpft war. Aufgabe der drei Teilprojekte in dieser Themenlinie wird es sein, zentrale Innovationsfelder und deren Charakteristiken auszumachen. Methodisch wird zu klären sein, ob der Begriff der Innovationskultur eine hinreichende analytische Schärfe aufweist, um ökonomische, technische und wissenschaftliche Innovationen gleichsam betrachten zu können.
- Dr. des. Juliane Czierpka, Die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl in den strategischen Überlegungen der Unternehmen des Ruhrbergbaus bis zum Ende der 1960er Jahre
- Daniel Dören, Die Unternehmensstrategie der Bergwerksgesellschaft Hibernia Aktiengesellschaft 1945-1968
- Nikolai Ingenerf, Von der Mechanisierung zum vernetzten System – Automatisierung des Ruhrbergbaus seit den 1960er Jahren
- Martha Poplawski, Arbeitswissenschaften und die Praxis der Betriebsführung im Steinkohlenbergbau nach 1945
In der Themenlinie Transformation von Industrielandschaften (Projektleitung: Dr. Michael Farrenkopf) werden die Konversionsprozesse montanindustriell geprägter Industriereviere unter vorrangig politischen und ökonomischen Gesichtspunkten sowie den daraus abgeleiteten Strategien der (industrie-)kulturellen In-Wert-Setzung untersucht. Zentrale These ist, dass die ökonomische Dimension des sukzessiven Rückzugs des aktiven Steinkohlenbergbaus dem Strukturwandel an der Ruhr eine Pionierrolle bei der Etablierung industriekultureller Transformationsleistungen im nationalen Kontext zugewiesen hat. Diese These soll durch aufeinander aufbauende Vergleichsstudien der westdeutschen, sächsischen und schließlich britischen Steinkohlenreviere geprüft werden. Somit ist vorgesehen, die Rolle und Bedeutung des Steinkohlenbergbaus in Bezug auf die Ausprägung industrieller Kulturlandschaften im UNESCO-Welterbe zu historisieren.
- Dr. Torsten Meyer, «Industrielle Kulturlandschaften» und Prozesse ihrer Authentifizierung - «Ironbridge Gorge», «Blaenavon Industrial Landscape» und das Ruhrgebiet
- Jana Tarja Golombek, "Please fill the gap" – (Industrie)Kultur als postindustrieller Platzhalter? Der Großraum Pittsburgh und das Ruhrgebiet seit den 1970er Jahren
- Kathrin Kruner, Konversionsprozesse im sächsischen Steinkohlerevier nach 1945
- Eva Nüsser, Industriearchäologische Analyse der Steinkohlenindustrie in der Region Westfalen-Lippe. Bestandsaufnahme und Kategorisierung von Denkmalzechen