|
Dr. Bilal Bay
Anthropogen induzierte Bodenerosion und Deltavorbau im Büyük Menderes Delta
(SW-Türkei)
> Einleitung
|
Gerade im ägäischen Raum
in Gebieten gut dokumentierter früher Hochkulturen, wie z.B. Troja,
Ephesos oder Milet, bieten sich hervorragende Möglichkeiten
interdisziplinärer Umweltforschung (vgl. Abb.1). Die Kulturlandschaft,
wie sie heute existiert, stellt nicht die ursprüngliche Naturlandschaft,
die vorherige Kulturen vorfanden dar und wurde durch den siedelnden
Menschen lokal z.T. stark verändert.
Neben
der einzelnen Fundstätte werden heute in Surveys kombiniert mit
geoarchäologischen Untersuchungsmethoden die Besiedlungsgeschichte und
der Naturraum früherer Kulturen rekonstruiert, um so die geogen oder
anthropogen bewirkten Veränderungen zu erfassen und zu interpretieren.
Besonders verfüllte
Meeresbuchten, wie der 500 km2 große Unterlauf des Büyük
Menderes Delta, stellen bedeutende Archive zur Bilanzierung von
natürlichen und anthropogen erzeugten Stofftransportes dar. Gestützt auf
Bohr- und historischen Daten wurden die Verlandungsstadien und die
maximale Ausdehnung des ehemaligen Latmischen Golfes untersucht.
Keramikscherben dienten zur Datierung von Hangablagerungen im Umland von
Milet.
Das Naturraumpotential
für das milesische Umland war bisher noch ungeklärt und wurde kontrovers
diskutiert. Seit 1990 laufen intensive archäologischen Survey-Arbeiten
in der Chora von Milet mit einer verstärkten interdisziplinären
Zusammenarbeit (Geologie, Geomorphologie, Geophysik). |
|
| |
|
| |
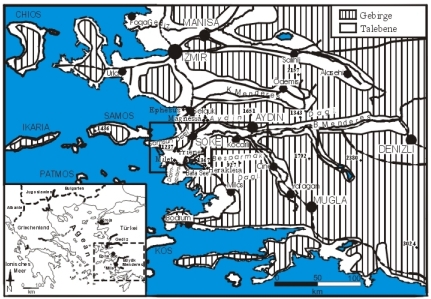
|
| |
1.
Übersichtskarte von SW-Anatolien
mit dem Arbeitsgebiet im Unterlauf des Büyük Menderes (gerahmt). |
|
> Paläogeograhie
und Deltavorbau im ehemaligen Latmischen Golf
|
Marine Sedimente
unter der Deltaebene reichen in der etwa in 5000 Jahren verlandeten
Meeresbucht („Latmischer Golf“) von der Deltamündung etwa 60 km
landeinwärts bis südlich der Provinzhauptstadt Aydin (vgl. Abb. 3). Die
Sedimentverteilung unter der Talebene des Büyük Menderes konnte
flächendeckend aus über 200 Bohrungen rekonstruiert werden (vgl. Abb.
2). Der Delta-Vorbau konnte, beginnend in chalkolithischer Zeit (6000
BP) bis heute, in 6 Verlandungsstadien unterteilt und deren
Suspensionsfracht nach Zeit und Volumen aufgeschlüsselt werden (vgl.
Abb. 4). Die Sedimentraten steigen in der dicht besiedelten Phase von
archaischer bis in die römische Zeit auf das 15-fache an und besitzen
ein Maximum in klassisch/hellenistischer Zeit (vgl. Abb. 4 u. 8). Der
mechanische Sedimentabtrag im 25 000 km2 großen
Einzugsgebiet des Büyük Menderes erreichte in den letzten 5000 Jahren
insgesamt 0,2 – 0,5 m.
Eine lokale Kurve
des holozänen Meeresspiegels wurde anhand Radiokarbondatierungen
(Mollusken/Korallen) von Kernproben aus dem Büyük Menderes Delta
näherungsweise ermittelt. Der wesentliche Anstieg auf etwa - 5 m u. NN
war ca. 3500 BP erreicht. Dies war vermutlich auch der Zeitpunkt max.
Meeresvorstoßes in den Buchtraum. |
|
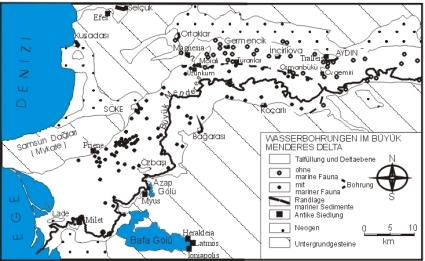
2.
Verteilung der erfassten
Bohrungen westlich von Aydın. In der marinen Fauna zeichnet sich
die maximale Ausdehnung des ehemaligen Latmischen Golfes ab. |
|
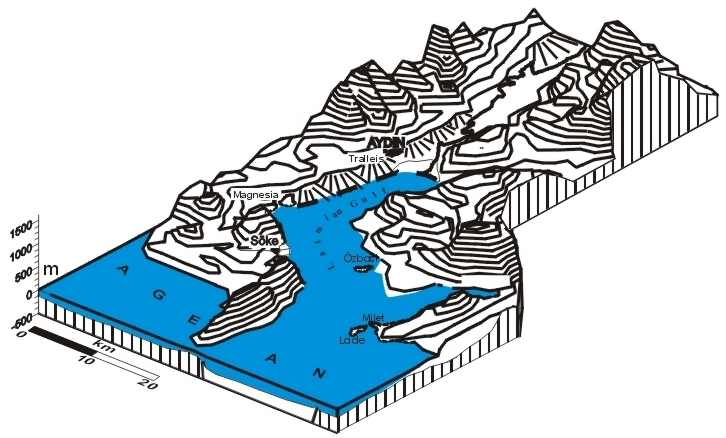 |
|
3.
3-D Darstellung des
Latmischen Golfes. Die maximale Buchtausdehnung war vermutlich schon
4000 BP erreicht. |
| |
|
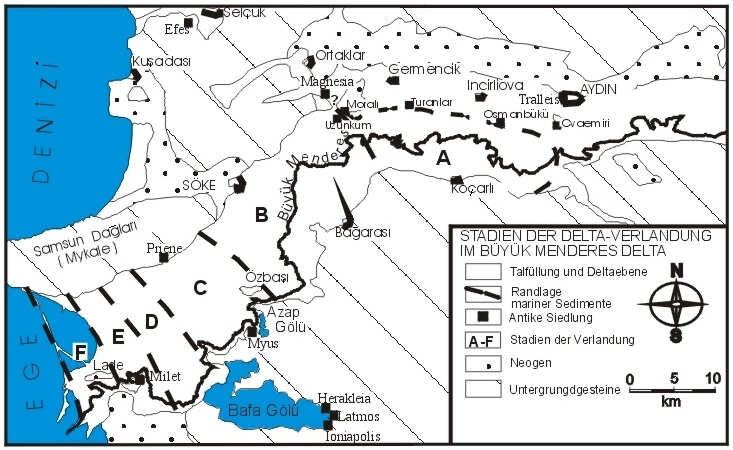
|
|
4.
Delta Verlandungsstadien (A-F), die sich an historischen Daten
orientieren. |
|
|
|
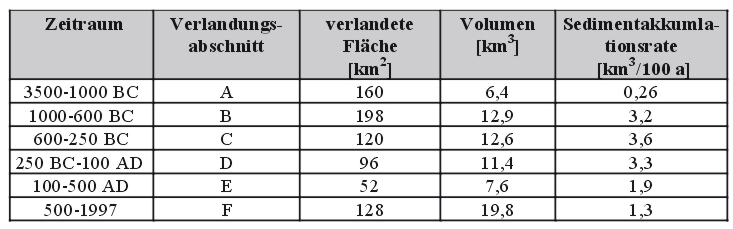 |
|
5.
Auflistung der
Sedimentakkumulationsraten seit dem Beginn des Delta-Vorbaus im
mittleren Holozän. Die Raten steigen mit dem anthropogenen Eingriff ab
1000 BC (Verlandungsabschnitt B) rapide auf das 15-Fache an und halten
dieses hohe Niveau bis zur römischen Zeit (Verlandungsabschnitt D). Erst
in spätrömisch-byzantinischer Zeit (Verlandungsabschnitt E) nehmen die
Sedimentationsraten wieder ab. |
| |
| |
|
|
> Paläoböden im Umland von Milet
Am Nordhang des Dorfes
Yeniköy, etwa 4 km südöstlich vom antiken Milet entfernt, entstand ab 1995
für geoarchäologische Untersuchungen eine einmalige Gunstsituation mit
zahlreichen Hangaufschlüssen in Form von großdimensionierten
Brunnengrabungen (vgl. Abb. 6), die eine Einsicht in die komplette
Hanggeschichte ermöglichten.
Für die Datierung der
holozänen Einheit diente die Keramik, die schichtweise beprobt und
anschließend durch die Zusammenarbeit mit der Archäologie bestimmt werden
konnte. Überraschend war eine dichte Verteilung von spätchalkolitischer
Keramik, die auf eine erste dichte Besiedlung des Hanges in 4 Jt. v. Chr.
schließen lässt. Der untere dunkle Horizont wies ein
spätchalkolithisch-archaisches Alter, die helle Zwischenlage ein
frühklassisch-römisch und die obere dunkle Lage ein
römisch-frühbyzantinisches Alter auf (vgl. Abb. 7).
Detaillierte bodenkundliche
Untersuchungen zeigten, dass es sich bei den markanten dunklen Lagen in dem
Beispielprofilen (vgl. Abb. 7) um z. T. in situ erhaltene Paläoböden
handelte. Die Stratigraphie deckte eine aufeinanderfolge von Bodenhorizonten
auf, die von kolluvialen Erosionssedimenten zwischengelagert werden.
Anschließende Mikrogefügeuntersuchungen belegten , dass es sich um stark
anthropogen genutzte Pflughorizonte handelt, die durch Erosion gekappt
wurden und ein nährstoffarmer, überverdichteter Pflugunterboden erhalten
blieb. Der ältere Paläoboden wurde in archaischer Zeit durch Düngeeintrag
stark überprägt. Es bildete sich ein ca. 1 m mächtiger homogener
Bodenhorizont, der vergleichbar ist mit Plaggenböden oder heutigen
Gärtenböden. Der untere Pflughorizont wird in der
spätarchaischen/frühklassischen Zeit einsetzenden Erosionsphase durch
Hangablagerungen überlagert. Erst in römischer Zeit konnte sich erneut ein
Boden bilden, der ebenfalls durch intensive landwirtschaftliche Nutzung fast
vollständig erodiert wurde.
Diese Befunde gaben massive
Hinweise auf intensive anthropogene Nutzung des Umlandes von Milet, die mit
dicht besiedelten Phasen korreliert werden konnten.
|
|
|
|
|
| |
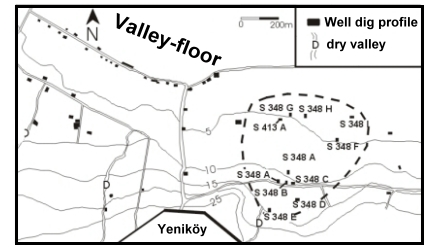 |
|
6.
Verteilung der Brunnengrabungen im Umfeld von Milet. |
|
|
|
 |
|
7.
Detailansicht der Brunnengrabung S 348 A. Die
dunklen Lagen repräsentieren kultivierte Paläoböden (Pflughorizonte). Die
holozäne Einheit beginnt mit der unteren dunklen Lagemit chalcholithischer
Keramik (~5500 BP). |
|
|
|
|
|
| |
| |
|
> Anthropogen induzierte
Bodenerosion |
|
Der menschliche
Einfluss im Umland von Milet beginnt im Spätneolithikum auf fruchtbaren,
humusreichen Böden. Auf den silikat- und karbonatreichen neogenen
Lockergesteinen der Balat-Fomation hatten sich seit Ende der letzten
Eiszeit (8000 v. Chr.) fruchtbare Böden entwickelt. Schon im frühen 4 Jt.
v. Chr. war dieser Gunstraum von den Chalkolitikern bereits dicht
besiedelt und landwirtschaftlich genutzt. Dabei kam es zum ersten
intensiven Eingriff in die Naturlandschaft mit verstärkter
Rodungstätigkeit des damals dicht bewaldeten Gebietes. Der Waldrückgang
wird sowohl durch Holzkohleanreicherung in dem unteren Päläoboden als
auch durch Pollendaten angedeutet. Nach einem starken Siedlungsrückgang
in der Bronzezeit erfolgte eine dichte Wiederbesiedlung des Umlandes in
früharchaischer Zeit, wobei es zu einer intensiven Umwandlung der Natur-
in eine Kulturlandschaft mit der Bildung von ca. 1 m mächtigen
Pflughorizont kam. Tierknochenauswertungen für die archaische Zeit
zeigen eine gut entwickelte Viehwirtschaft mit der Dominanz des Schafes.
Der Anteil der Bauern an der Gesamtbevölkerung wird in archaischer Zeit
auf 80-90% geschätzt. Nach der intensiven Zerstörung der
Vegetationsdecke setzt spätarchaisch/ frühklassischer Zeit verstärkter
Hangabtrag ein, die bis in römische Zeit andauerte. Der archaische
Bodenhorizont wurde mit einer bis zu 3 m mächtigen kolluvialen Lage
bedeckt. In römischer Zeit kommt es durch Siedlungsrückgang des Umlandes
wieder zu einer Erholung der Landschaft und zu einer Bodenbildung. Nach
einer kurzen intensiven landwirtschaftlichen Nutzung in
frühbyzantinischer Zeit setzte ein erneuter Abtrag des Bodens ein.
Ähnliche Arbeiten im
mediterranen Raum zeigen Erosionsphasen, die ebenfalls je nach lokalem
Besiedlungsmuster heterochron einsetzen (vgl. Abb. 8). Die
Untersuchung der holozänen Bodenerosions- und
Talboden-Akkumulationsgeschichte zeigen stabile Landschaftsphasen im
frühem Holozän. Mit der chalkolitischen Zeit setzt regional
unterschiedlich verbreitete Bodenerosion nach Einzug von Siedlung und
Ackerbau ein.
Instabile Hangphasen und
Aufbau von Talfüllungen sind episodisch und tauchen in verschiedenen
Zeiten mit verschiedenen Intensitäten und verschiedenen Orten auf, die
immer mit dichter Besiedlung und Phasen intensiver Landnutzung
zusammenfallen. Dies spricht gegen klimatische Ursachen.
In zwei von drei
untersuchten Gebieten in Griechenland waren die ersten Phasen der
Bodenerosion mit Talverfüllung die am weitesten ausgebreiteten und
volüminösesten.
Die historische
Bodenerosion in Griechenland und der westanatolischen Küste kann in
dicht besiedelten Gebieten als „katastrophal“ bezeichnet werden. |
| |
|
| |
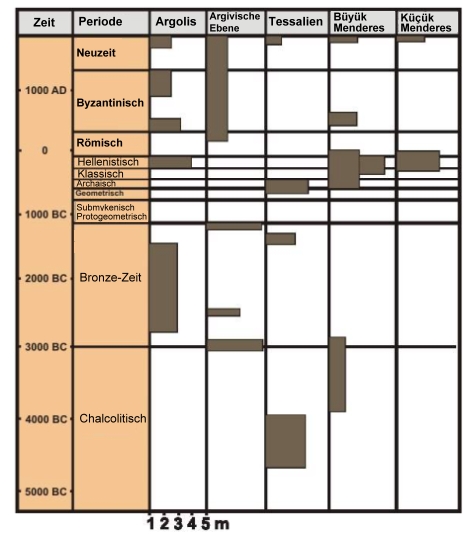 |
| |
8.
Erosions-/Akkumulations-Sequenzen in
geoarchäologisch gut untersuchten Gebieten in Griechenland im Vergleich mit
den Siedlungsräumen des Büyük und Kücük Menderes. Die tabellarische
Darstellung verdeutlicht die je nach Besiedlungsmuster lokal heterochron
einsetzenden Erosionsphasen mit stark unterschiedlicher Dauer, Intensität und
räumlicher Verteilung. Dies spricht eindeutig für anthropogene und
gegen klimatische Ursachen der holozänen Erosionsphasen. |
|
> Zusammenfassung
|