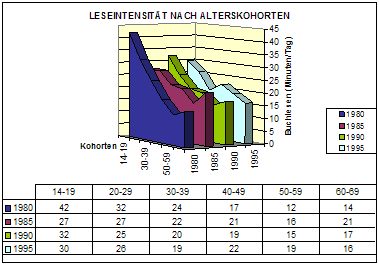
PROJEKTBESCHREIBUNG UND BIBLIOGRAPHIE
PROJEKTBESCHREIBUNG
I ARBEITSBEREICH LESEN IM ALTER
a) Der Status quo: Die Leseintensität sinkt mit zunehmendem Alter
Der PISA-Schock hat die Aufmerksamkeit der Forschung und der breiteren Öffentlichkeit fast ganz auf die Problematik der sinkenden Lesekompetenz von Kindern und Jugendlichen verengt. Dabei ist seit längerem bekannt, dass diese Altersgruppen im direkten Vergleich zwischen den Alterskohorten nicht etwa besonders schlecht, sondern besonders gut abschneiden. In der folgenden Graphik sind die Ergebnisse der bekanntesten Studien, die diesen Sachverhalt beschreiben, zusammenfassend dargestellt:
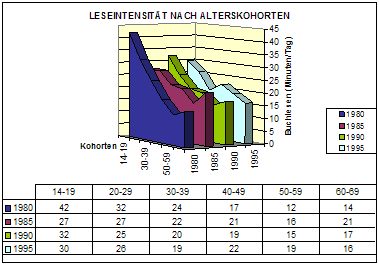
Die dieser Graphik zugrunde liegende Metastudie (Berg/Kiefer 1996, S. 309-317) verdeutlicht einen seit Beginn der Leseforschung immer wieder bestätigten Trend, nämlich dass die Buchlektüre bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen einen Höhepunkt erreicht und dann im Verlauf des Lebens fast kontinuierlich absinkt. Die Entwicklung dieses Trends von 1980 bis 1995 spiegelt hierbei in der Hauptsache die zunehmende Tertiärisierung der Gesellschaft und die allgemeine Anhebung des durchschnittlichen Bildungsniveaus wider. Der altersspezifische Effekt bleibt also auch in der Gegenwart noch erhalten. Dass die Steilheit der oben abgebildeten Kurven etwas reduziert werden konnte, liegt nicht an einer Steigerung der Leseintensität bei Senioren, sondern an einer Absenkung der Leseintensität bei Junioren.
Neuere Studien zur Entwicklung des Mediennutzungsverhaltens älterer Menschen verdeutlichen, dass die Medienkonkurrenz für die Aufrechterhaltung des beschriebenen Großtrends unter den Bedingungen der Massenmediengesellschaft in erheblichem Ausmaß verantwortlich zu machen ist. Insbesondere das Fernsehen hat sich – weitgehend unbemerkt – zu einem Seniorenmedium par excellence entwickelt. Die besorgten Warnungen vor einem Übergang von der ‚Buchkindheit’ zur ‚Fernsehkindheit’ bzw. zur ‚Computerkindheit’ haben auch hier wieder den Blick darauf verstellt, dass mit mindestens gleichem Recht von einer problematischen Veränderung weg von einer lesenden und hin zu einer fernsehenden Seniorenschaft gesprochen werden muss:
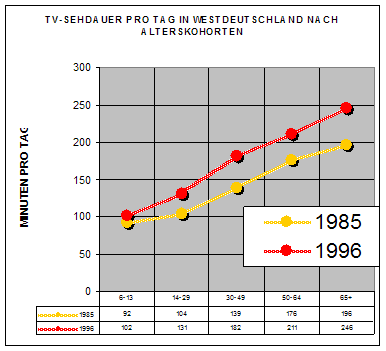
Die Studie, auf der diese Graphik basiert (Darschin 1998, S. 32), lässt keinen Zweifel an der Verteilung des Zeitbudgets in Seniorenhaushalten: Der TV-Konsum nahm und nimmt weiterhin mit steigendem Alter beständig zu, hat sich zwischen 1986 und 1995 in allen Altersstufen, vor allem aber bei den Seniorinnen und Senioren (plus 50 Minuten!) noch einmal deutlich erhöht und übertrifft außerdem den der Printmedien – wie zahlreiche andere Studien belegen – um den Faktor 3 bis 4 (s. Eckhart/Horn 1988; Raumer-Mandel 1990; Stiftung Lesen (Hg.) 1991; Stiftung Lesen (Hg.) 1992/93; Bonfadelli 1999; Media Analyse 2001).
b) Die Konsequenzen: Welche gesellschaftlichen Probleme ergeben sich aus diesen Befunden?
Die starke Dominanz des TV-Konsums im Seniorenalter hat sowohl für die Senioren selbst als auch für ihre soziale Umgebung eine Reihe negativer Konsequenzen.
- Erstens ist in diesem Zusammenhang auf das Problem der verringerten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben hinzuweisen. Zahlreiche Untersuchungen zum ‚Vielseher-Syndrom’ bestätigen, dass Vielseher im Durchschnitt nicht nur älter und einkommensschwächer als Wenigseher, sondern tendenziell auch ungebildeter, politisch und kulturell desinteressierter sowie emotional unglücklicher, einsamer, unzufriedener sind (s. Buß 1985; Übersicht über entsprechende Forschungsergebnisse bei Bonfadelli 2000 II, 159-162). Der gesteigerte TV-Konsum vieler Seniorinnen und Senioren kann deshalb nicht als Konsequenz einer bewussten, freiwilligen Entscheidung hinsichtlich ihrer Freizeitgestaltung interpretiert werden.
- Zweitens ist vor dem Hintergrund der Wissenskluft-Hypothese mit negativen Konsequenzen hinsichtlich einer Verstärkung der Unterschiede zwischen Bildungs- und Gesellschaftsschichten zu rechnen, die hier unter Rekurs auf die aktuelle Lebensstilsoziologie (SINUS-Milieus; vgl. Schneider 2004) beschrieben werden sollen. Es entstehen dramatische sozial-kulturelle Abstände zwischen einer Minderheit hoch gebildeter, ihre Lebenserfahrung ausnutzender und sozial integrierter ‚altersloser Alter’ einerseits und einer Mehrheit paralysierter, ihre Möglichkeiten ungenutzt lassender ‚gealteter Alter’ andererseits. Auch hier verdient die Migrationsproblematik besondere Beachtung.
- Drittens und vor allem ist mit gravierenden Auswirkungen hinsichtlich der kindlichen Lesesozialisation zu rechnen. Die Entwicklung des Leseverhaltens basierte und basiert maßgeblich auf der familiären Lesesozialisation, d.h. auf den Einflüssen, denen das Kind in den ersten Jahren seines Lebens ausgesetzt ist. Die den gesellschaftlich-wirtschaftlichen Modernisierungsprozess unausweichlich begleitende Veränderung der Familienstrukturen bringt es jedoch mit sich, dass die Kindererziehung zu einem gewichtigen Teil in den Händen jener jüngeren Senioren liegt, die schon aus dem Berufsleben ausgeschieden, aber noch nicht in Seniorenheime oder ähnliche familienfernere Wohnstätten umgezogen sind. Bei dieser Altersgruppe der ca. 60-Jährigen (durchschnittliches faktisches Renteneintrittsalter) bis ca. 78-Jährigen (durchschnittliches Alter bei Einzug in ein Seniorenheim) liegt heute de facto ein großer Teil der Verantwortung für die Lesesozialisation der jüngeren Generationen. Wenn aber, wie oben gezeigt, in dieser Altersgruppe der TV-Konsum die Nutzung aller Printmedien zusammen um das Drei- bis Vierfache übersteigt, ist mit negativen Auswirkungen auf die Entwicklung des Mediennutzungsverhaltens der Kinder und Jugendlichen zu rechnen. Denn wenn Oma und Opa zwar dann und wann mit dem Kind zusammen ein Buch durchgehen, selbst aber den weitaus größten Teil ihrer Freizeit vor dem TV-Gerät verbringen, wird die (Vor-) Lesesituation als spezielle Erziehungssituation erlebt und nicht als Normalfall, dem es nachzuleben gilt. Da aber die um 1945 Geborenen noch eine schriftorientierte Mediensozialisation erfahren haben, kann ihr jetziges Mediennutzungsverhalten positiv beeinflusst, d.h. im Hinblick auf eine Reaktivierung verschütteter Lesekompetenzen verbessert werden.
c) Die Ursachen: Warum lesen ältere Menschen weniger als jüngere?
Will man die drei genannten Negativfolgen des übermäßigen TV-Konsums vieler Senioren beseitigen, muss man zunächst nach den Ursachen für die Asymmetrie im Mediennutzungsverhalten dieser Altersgruppe fragen. Dabei sollen die Begriffe ‚Alter’ und ‚Seniorinnen/Senioren’ im Sinne der modernen Gerontolinguistik als gesellschaftliche Konstrukte aufgefasst werden (vgl. Kohrt/Kucharczik 2003).
- Erstens ist dann auf die – wenigstens aus subjektiver Perspektive – positiven Wirkungen des Fernsehens einzugehen, die besonders auf emotionaler Ebene anzusiedeln sind: Zu vergleichsweise geringen Kosten reduziert häufiges Fernsehen durch den Aufbau parasozialer Beziehungen zu TV-Protagonisten Einsamkeitsgefühle, es strukturiert den Tages- und Wochenablauf, es bietet Entspannung und Unterhaltung und es scheint auch die Stimmung tendenziell aufzuhellen (vgl. Bonfadelli 2000 II, S. 161f.; Schneider 2003). Das Fernsehen stellt also eine sehr starke Konkurrenz für das Lesen dar, weil es die spezifischen Negativ- und Mangelerfahrungen eines großen Teiles der Senioren auf mühelose Weise zu kompensieren erlaubt. Dass diese Mühelosigkeit mit der Gefahr einer Infantilisierung einhergeht, ist von Medienkritikern wie Neil Postman immer wieder zu Recht hervorgehoben worden.
- Zweitens ist auf medizinisch-biologische Besonderheiten hinzuweisen, die das Lesen im Alter allem Anschein nach – dies wäre genauer zu überprüfen - erschweren: Die Schriftdechiffrierungsfähigkeit lässt nach, die erforderliche Lesehaltung wird im Vergleich zur Körperhaltung im Fernsehsessel zunehmend als unkomfortabel empfunden, die Konzentrations- und Merkfähigkeit wird tendenziell reduziert, die seit dem 18. Jahrhundert durchgesetzte Praxis des stummen einsamen Lesens wie auch der Trend zum Vorlesenlassen (Audiobooks) lassen die diätetisch-therapeutischen Wirkungspotentiale des Phantasie, Atmung und Kreislauf anregenden (lauten, geselligen) Lesens zum Nachteil besonders der älteren Leser nicht mehr zur Geltung kommen (vgl. Schön 1987).
- Drittens ist auf das prima facie überraschende Faktum hinzuweisen, dass nur 13 % der Jugendlichen im Alter von 14 bis 19 Jahren, aber 32 % der Erwachsenen ihre Leseabstinenz damit begründen, dass das Lesen sie zu sehr anstrenge (Franzmann 2002, S. 35). Hier liegt noch Stoff für weitere Untersuchungen, denn der Begriff der ‚Anstrengung’ ist hierbei nicht eindeutig definiert. Da das Lesen eine komplexe Tätigkeit ist, die sich in mehreren Phasen vollzieht, kommen hierbei vom Akt des Entzifferns über die Entschlüsselung von Syntax und Semantik bis hin zum Textverstehen durch Konstruktion mentaler Modelle viele verschiedene Tätigkeiten in Betracht, die (von weniger geübten Lesern) im Vergleich etwa mit der Tätigkeit beim Fernsehen als ‚anstrengend’ wahrgenommen werden können. Darüber hinaus kann hier im Falle der Senioren eine von der neueren Freizeitwissenschaft beschriebene Problematik von Bedeutung sein: Die den heutigen Lebensverhältnissen nicht mehr gerecht werdende Ineinssetzung von Arbeitszeit mit Obligationszeit und von Freizeit mit Dispositionszeit kann, wenn das Rentenalter fälschlich als reine Dispositionszeit wahrgenommen wird (‚unbegrenzter Urlaub’), zur Zurückweisung aller ‚überflüssigen’ Anstrengungen führen, da diese als unfreiwillige Rückversetzung in die obligate Berufstätigkeit erlebt werden (vgl. Opaschowski 1997, S. 287-333). Das Lesen wird dann womöglich mit jener als berufstypisch erlebten Selbstdisziplinierung assoziiert, von der man sich endgültig befreit zu haben hoffte.
Ferner ist in diesem Zusammenhang die Möglichkeit in Erwägung zu ziehen, dass die aktuellen Mediennutzungsgewohnheiten der Seniorinnen und Senioren teilweise auf Akkomodationseffekten beruhen: Ältere Menschen imitieren bis zu einem gewissen Grad als modern geltende Mediennutzungsgewohnheiten, um selbst Anschluss an die Medienentwicklung zu halten und vom Jugendlichkeits- oder Fortschrittlichkeitsimage der elektronischen Medien zu profitieren.
Zu diesen drei Faktoren kommen weitere hinzu, die von der Leseforschung schon detaillierter analysiert wurden, wie z.B. die Desorientierung angesichts der Publikationsfülle, die Schwellenangst beim Betreten von Buchhandlungen und Bibliotheken, der im Verhältnis zu den TV-Gebühren als zu hoch empfundene Preis von Printmedien, das in Unterschichtenmilieus geringe Ansehen des Lesens in der peer group u.ä.
d) Wie können die beschriebenen Probleme gelöst werden?
In Anbetracht der Attraktivität des Fernsehens gegenüber der Lektüre muss vor übertriebenem Optimismus bezüglich der Steigerbarkeit der Leseintensität von Senioren gewarnt werden. Da jedoch, wie oben gezeigt, ein großer Teil der Senioren eine schriftorientierte Mediensozialisation erfahren hat und außerdem oft nicht aus innerstem Antrieb, sondern faute de mieux zu TV-Vielsehern wird, besteht andererseits auch kein Anlass zu übertriebenem Pessimismus. Fünf Maßnahmen zur Lösung der beschriebenen Probleme verdienen genauere Untersuchung:
- Erstens ist auf der Basis eines zielgruppengerechten Konzeptes von adäquaten Schreib- und Lesekompetenzen an Maßnahmen zur Reaktivierung verschütteter Lesekompetenzen zu denken. Senioren können wirkungsvolle Lesevorbilder sein, wenn sie das Lesen selbst als anregende, stimulierende Tätigkeit und nicht als asketische Übung wahrnehmen. In dieser Hinsicht wäre insbesondere auf die Gründung von Leseclubs hinzuwirken, in denen sich ältere Menschen über Gelesenes austauschen können und in denen sie Anregungen für neue Lektüre erhalten. Büchereien, Volkshochschulen, Seniorenbegegnungsstätten und ähnliche Orte sind in die Konzeption und Durchführung solcher Maßnahmen einzubeziehen. Die Möglichkeit zur Implementierung von Verfahren eines produktionsorientierten Unterrichtes in die Gerontopädagogik ist hierbei zu erforschen.
- Zweitens ist an die Unterstützung von Maßnahmen in den Bereichen Buchproduktion und Buchmarketing zu denken, die auf die körperlichen Gegebenheiten älterer Menschen abstellen: größer gedruckte, leichtere (d.h. u.U. auf mehrere dünnere Bände verteilte) Bücher, ergonomisch gestaltete Lesemöbel (s. Hanebutt-Benz 1985), leichter zu handhabende Sehhilfen (Lupen), Software zur Steigerung der Lesbarkeit von Internetseiten usw.
- Drittens wäre dafür zu werben, dass in den von Senioren de facto präferierten Fernsehprogrammen ein höherer Anteil an schriftlicher Information erscheint. Denn nicht das Buch gegenüber dem Fernsehapparat, sondern das Lesen gegenüber dem (Bilder) Sehen soll ja gefördert werden. Analoges gilt für die inzwischen recht zahlreichen Internetangebote für Senioren (vgl. etwa die Zusammenstellung bei Mollenkopf/Doh 2002, S. 24f.).
- Viertens ist in diesem Zusammenhang von einer zu einseitigen Verengung der seniorenspezifischen Medienproblematik auf das Thema ‚Senioren ins Internet’ abzurücken. Vor dem Hintergrund der Wissensklufthypothese ist sogar zu befürchten, dass die oben beschriebene Verschärfung sozialer Unterschiede durch einen bloßen Wechsel von der TV- zur Internetnutzung nicht gelöst, sondern konserviert und teilweise sogar verschärft werden.
- Fünftens ist dies die Umlenkung eines Teiles der direkt zur außerfamiliären Leseförderung bei Kindern und Jugendlichen eingesetzten Mittel auf die Leseförderung bei Senioren, die nicht mehr im Berufsleben stehen und noch nicht in Seniorenheime oder ähnliche Einrichtungen gezogen sind (ca. 60- bis 78-Jährige; s.o.), und zwar– aus den oben dargelegten Gründen – zum Zwecke einer nachhaltigen indirekten Verbesserung der letztlich ausschlaggebenden familiären Lesesozialisation von Kindern und Jugendlichen!
Über diese fünf Maßnahmen hinaus ist an weitere Aktionen zu denken, zu denen etwa die Einbindung von Senioren in die schulische Leseförderung (Senioren als freiwillige Vorleser in Schulen und Kindergärten), die Verstärkung seniorenspezifischer Angebote in Bibliotheken, die Durchführung von Seniorentagen im Buchhandel, die Organisation von Lesetagen (‚eine Stadt liest ein Buch’), die Etablierung von Seniorenbestsellerlisten u.ä. gehören können.
II ARBEITSBEREICH SCHREIBEN IM ALTER
Vor dem Hintergrund der modernen Soziolinguistik sowie der pragmatisch orientierten Sprachgeschichtsschreibung (v. Polenz 1999) stellt die Analyse generations- und altersspezifischen Sprachverhaltens ein wichtiges Desiderat dar. Während der Sprachgebrauch von Kindern und Jugendlichen seit langem einen wesentlichen Untersuchungsgegenstand der Linguistik bildet, ist die Sprache der älteren Generationen erst in jüngerer Zeit in den Blick genommen worden, und dies in Deutschland erst mit gewisser Verzögerung (Thimm 2000; Fiehler/Thimm 2003). Die Gerontolinguistik hat sich jedoch bislang in erster Linie auf die Beschreibung gesprochener Sprache (Alltagsgespräche, Kommunikation in Pflegesituationen usw.) konzentriert, während schriftliche Texte kaum Beachtung gefunden haben. Für eine angemessene Beschreibung der generationsspezifischen „Register“ (Kohrt/Kucharczik 2003) sollte jedoch das gesamte potentielle Spektrum unterschiedlicher Textsorten berücksichtigt werden.
Als Basis ist zunächst eine Erfassung der tatsächlichen Textproduktion erforderlich. Wie erste Untersuchungen zur Schriftlichkeit im Alltag gezeigt haben, scheint sich die Schreibtätigkeit vieler Sprachteilhaber/innen auf Textsorten wie Notizzettel, Formulare usw. zu beschränken (Brede-Rettberg 1990); das gilt auch für Berufstätige (Häcki Buhofer 1985), zumal heute auch im Geschäftsleben normalerweise mit vorgegebenen Textbausteinen gearbeitet und somit ein halbliterales Verhalten gefördert wird (Grimberg 1988, 159f.). Genauere Erkenntnisse über Art, Umfang und Bedingungen der schriftlichen Textproduktion namentlich der älteren Generation liegen jedoch nicht vor. Neben den genannten primitiven, d.h. weitgehend standardisierten Textsorten wie Einkaufszettel, Formulare, Kreuzworträtsel usw. lohnen weitere Textsorten privater Schriftlichkeit eine genauere Untersuchung. In Betracht kommen dabei insbes. persönliche Aufzeichnungen (Tagebücher) und private Korrespondenz (Briefe, Karten), halböffentliche Korrespondenz (z. B. Schriftverkehr mit Behörden), ferner öffentliche Äußerungen (z. B. Leserbrief-Debatten).
Geplant ist zunächst eine Fragebogenerhebung zur allgemeinen Erfassung der Textproduktion von Angehörigen der älteren Generation. Dazu sollen Informationen über Schreibanlässe, Textsorten, Textumfang usw. erfasst werden. Die Fragestellung lautet dabei ganz generell: Wer schreibt wem zu welchem Anlass welche Texte? Diese Daten werden mit Sozialdaten (Alter, Bildungsstand, Berufstätigkeit, Familiensituation, gesundheitliche Situation usw.) korreliert. Von besonderem Interesse ist der Zusammenhang zwischen Mediennutzung (insbes. Fernsehen, Telefon und Internet) und Schreibverhalten (z. B. Anruf vs. Brief). Darüber hinaus sollen die Informanten ihr Schreibverhalten reflektieren und sich zu Problemen (Schreibschwierigkeiten, Formulierungsprobleme usw.) äußern (vgl. Keseling 2004); anzusprechen sind dabei zum einen das Wissen um die Gestaltung spezifischer Textsorten, zum anderen das Bewusstsein um spezifische Normen im Bereich der Schriftsprache (vgl. allgemein Koch/Oesterreicher 1996). Die Fragebögen sollen durch strukturierte Interviews ergänzt werden, sofern dies im Rahmen der Fragestellung geboten ist.
Eine besondere Bedeutung kommt dem Bereich Briefkultur zu. Klagen über den vermeintlichen Verlust der Sprach- und Schreibkultur sind populär (Kübler 1985), allerdings keineswegs empirisch validiert (v. Polenz 1999, 103). Während das private Schreib- und Leseverhalten früherer Epochen bereits Thema von detaillierten Untersuchungen geworden ist (z. B. Schikorsky 1990), sind Briefwechsel und andere Formen der Korrespondenz des späten 20. und des 21. Jahrhunderts weitestgehend unberücksichtigt geblieben, sieht man von einzelnen Hinweisen ab (Cherubim/Hilgendorf 2003). Zwar liegen vereinzelt Ansätze vor, beispielsweise zur Textsorte „Liebesbrief“ (Wyss 2003), doch sind diese Analysen wegen der mangelhaften theoretischen Basis und methodischer Probleme für die Fragestellung wenig hilfreich; vielmehr zeigt die Durchsicht der einschlägigen Literatur, dass eine korpusbasierte, methodisch fundierte Beschreibung des Mediums „Privatbrief“ nach wie vor ein Desiderat darstellt. Zu einigen der hier interessierenden Bereiche existieren in beschränktem Maße quantitative Vergleichsdaten, die aus einer Ende der siebziger Jahre im Rahmen einer Werbekampagne für die Deutsche Bundespost („Schreib mal wieder“) durchgeführten Erhebung der „Einstellung der Bevölkerung zum Briefeschreiben“ resultieren (Lintas 1979; Titius 1984). Damit ist in beschränktem Maße auch die Möglichkeit eines diachronen Vergleichs gegeben, was Aussagen über die Veränderung sprachlichen Verhaltens in einem überschaubaren Zeitraum ermöglicht und damit Hinweise auf einen Sprachwandelprozess geben kann (real-time-Vergleich).
In einer Pilotstudie, in der es um die Erstellung erster Grundlagen für die zukünftige Arbeit gehen wird, soll anhand einer gut zugänglichen Textsorte ein geeignetes Analyseverfahren entwickelt und erprobt werden. Beabsichtigt ist dazu zunächst der Aufbau eines Korpus aus Glückwunschschreiben (Karten/Briefe). Für eine Pilotstudie bietet sich diese auf den ersten Blick wenig spektakuläre Textsorte aus verschiedenen Gründen besonders an: 1. Es handelt sich einerseits um eine weitgehend standardisierte Textsorte, so dass von vornherein eine hohe Vergleichbarkeit gegeben ist, andererseits kann im Rahmen der Textsortenkonventionen mit ideolektaler Sprachvariation gerechnet werden; 2. Die Texte sind von überschaubarem Umfang und können daher vollständig in die Untersuchung eingehen; 3. durch regelmäßige Schreibanlässe ist mit einer großen Menge an Texten zu rechnen; 4. derartige Schreiben werden zumeist aufbewahrt, sind aber nicht so persönlich wie beispielsweise Liebesbriefe und somit leicht zugänglich.
Die Texte des Korpus sollen unter linguistischen Kriterien untersucht und beschrieben werden. Dabei sind sowohl Aspekte der Textstruktur (Brinker 2001), der Textsortenkonventionen (Ermert 1979; Ettl 1984) und der zugrundeliegenden sprachlichen Normen als auch Gesichtspunkte der sprachlich-stilistischen Gestaltung heranzuziehen. Für die Analyse ergibt sich damit ein umfassender Kriterienkatalog, der von der Graphie der Texte (Schrift, Rechtschreibung, Interpunktion) über die Lexik (Wortschatz, Phraseologismen), Morphologie (Flexion, Wortbildung) und Syntax bis hin zur Pragmatik (Sprechakte) und Textgestaltung (Kohärenz, Themenentfaltung usw.) reicht.
Die Untersuchung derartiger Texte dürfte vielfältige Perspektiven für die Linguistik und deren Nachbardisziplinen eröffnen:
· Die Analyse solcher schriftlicher Texte ergänzt die bereits vorliegenden Studien zu mündlicher Kommunikation und ermöglicht so eine vollständige Beschreibung der „Sprache im Alter“. Daraus sind grundlegende Hinweise auf die Relation zwischen Alter/Generationszugehörigkeit und Sprachverhalten zu erwarten.
· Der letztgenannte Aspekt ist von hoher Bedeutung für eine Weiterentwicklung der angewandten Disziplin „Autorenerkennung“ im Rahmen der Forensischen Linguistik (Dern 2003). Wenn Hypothesen zum Autorenprofil anonymer Texte formuliert werden sollen, bedarf es empirisch validierter Aussagen zur Relation von schriftsprachlichem Ausdruck und Generationszugehörigkeit (Baldauf 1999, 101).
· Vor dem Hintergrund einer alternden Gesellschaft ist eine möglichst erschöpfende Beschreibung des Sprachverhaltens im Alter von zentraler Bedeutung für die Analyse und Erklärung aktuellen Sprachwandels, zumal Sprachgeschichte als Geschichte von Textsorten und Kommunikationsbereichen verstanden wird (Steger 1998). Besonderes Augenmerk muss dabei dem vieldiskutierten Einfluss moderner Medien auf die Sprache gelten.
III Konkrete Forschungsvorhaben
Die oben beschriebenen Probleme und Sachverhalte können im Rahmen eines Einzelprojektes nicht erschöpfend behandelt werden. Es wird vorgeschlagen, den Arbeitsauftrag des Projektes auf die folgenden Untersuchungsgegenstände zu konzentrieren:
BIBLIOGRAPHIE
Alter. Einführung in die Gerontologie. Stuttgart 3. Aufl. 1994, S. 202-229.
Amann, Anton: Die vielen Gesichter des Alters. Wien 1989.
Antos, Gerd / Hans P. Krings: Textproduktion. Ein interdisziplinärer Forschungsüberblick. Tübingen 1989.
Antos, Gerd / Pogner, Karl-Heinz: Schreiben. Heidelberg 1995 (Studienbibliographien Sprachwissenschaft 14).
Baacke, Dieter / Poelchau, Heinz-Werner (Hg.): Medien- und Kulturarbeit mit älteren Menschen. Didaktische Materialien 2. Bielefeld 1993 (= Schriften zur Medienpädagogik, hg. v. der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur in der Bundesrepublik Deutschland e.V. [GMK], Bd. 10), S. 5-8.
Bäcker, Gerhard / Dieck, Margret / Naegele, Gerhard / Tews, Hans Peter: Ältere Menschen in Nordrhein-Westfalen. Wissenschaftliches Gutachten zur Lage der älteren Menschen und zur Altenpolitik in Nordrhein-Westfalen zur Vorbereitung des Zweiten Landesaltenplans. Düsseldorf 1989.
Baldauf, Christa: Zur Signifikanz sprachlicher Merkmale im Rahmen des Autorschaftsnachweises: Ansätze und Desiderate der forensischen Linguistik. In: Archiv für Kriminologie 204 (1999), 93-105.
Baltes, Margret M. / Kohli, Martin / Sames, Klaus (Hg.): Erfolgreiches Altern - Bedingungen und Variationen. Bern/Stuttgart/Toronto 1989.
Baltes, Martin M.: Alltagskompetenz im Alter. In: Mayer, Karl U. / Baltes, Paul B. (Hg.): Die Berliner Altersstudie. Ein Projekt der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Interdisziplinäre Arbeitsgruppen. Forschungsberichte, Bd. 3. Berlin 1996, S. 525-542.
Berg, Klaus / Kiefer, Marie-Luise (Hg.): Massenkommunikation. Eine Langzeitstudie zur Mediennutzung und Medienbewertung. Bd. 5: 1964-1995. Baden-Baden 1996.
Bohnsack, Petra / Foltin, Hans-Friedrich (Hg.): Lesekultur. Populäre Lesestoffe von Gutenberg bis zum Internet. Marburg 1999.
Bonfadelli, Heinz „Lesen und Fernsehen – Lesen oder Fernsehen?“, in: Franzmann, Bodo et al. (Hgg.), Auf den Schultern von Gutenberg, Berlin u. München 1995, S. 229-240.
Bonfadelli, Heinz: Leser und Leseverhalten heute – Sozialwissenschaftliche Buchlese(r)forschung (= Bonfadelli 1999a). In: Franzmann u. a. 1999, S. 86-144.
Bonfadelli, Heinz: Literarische Sozialisation im Wandel. In: Garbe, Christine et al. (Hgg.): Lesen im Wandel. Probleme der literarischen Sozialisation heute. Lüneburg 1997. S. 41-54.
Borscheid, Peter: Geschichte des Alters - Vom Spätmittelalter zum 18. Jahrhundert. München 1989.
Bosch, Eva Maria: Alter in der fiktiven Fernsehrealität - Eine Analyse der Konstruktion von Altersdarstellungen und ihrer Perspektive durch ältere Menschen. In: Eckhardt, Josef / Horn, I: Ältere Menschen und Medien. Eine Studie der ARD/ZDF-Medienkommission. Frankfurt a.M. 1988 (= Schriftenreihe MEDIA PERSPEKTIVEN, hg. v. Klaus Berg und Marie-Luise Kiefer, Bd. 8), S. 131-149.
Brede-Rettberg, Anita: ‚Sie wissen doch, was ich meine': Schreibverhalten und Schreibschwierigkeiten erwachsener Schreiber und Schreiberinnen. In: Sprachreport 4 (1990), 3-4.
Brinker, Klaus: Linguistische Textanalyse. Eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden. 5., durchgesehene u. ergänzte Aufl. Berlin 2001 (Grundlagen der Germanistik 29).
Buhofer, Annelies: Das alltägliche Schreiben im Berufsleben. In: Grosse (1983), 137-178.
Burda Advertising Center (Hg.): Die Sinus-Milieus in Deutschland [2002]. Strategische Marketing- und Mediaplanung mit der Typologie der Wünsche Intermedia. Eine Dokumentation für Anwender. Erg. Neuaufl. Offenburg 2002.
Buß, Michael: Die Vielseher. Fernseh-Zuschauerforschung in Deutschland: Theorie – Praxis – Ergebnisse. Frankfurt a. M. 1985.
Buttler, Andreas: Schreib mal wieder … Werbewirkungsforschung im persönlich befragten Panel. In: Interview und Analyse 8 (1981).
Chartier, Roger / Cavallo, Guglielmo (Hg.): Die Welt des Lesens. Von der Schriftrolle zum Bildschirm. Übers. v. H. Jochen Bußmann u. a. Frankfurt a. M. u. New York 1999 [zuerst 1995 u.d.T. Storia della lettura nel mondo occidentale].
Cherubim, Dieter / Suzanne Hilgendorf: Sprachverhalten im Alter. Beobachtungen und Diskussionen zum Begriff des Altersstils. In: Fiehler/Thimm (Hgg.) (1998), 230-256.
Coupland, Nikolas / Justine Coupland / Howard Giles: Language, Society, and the Elderly. Oxford 1991.
Darschin, Wolfgang: Fernsehgewohnheiten und Programmbewertungen nach der Dualisierung des deutschen Rundfunksystems. In: Klingler 1998, S. 31-49.
Dern, Christa: Sprachwissenschaft und Kriminalistik: zur Praxis der Autorenerkennung. In: Zeitschrift für germanistische Linguistik 31 (2003), 44-77.
Donsbach, Wolfgang: Die Selektivität der Rezipienten. Faktoren, die die Zuwendung zu Zeitungsinhalten beeinflussen. In: Schulz, Winfried (Hg.): Medienwirkungen. Einflüsse von Presse, Radio und Fernsehen auf Individuum und Gesellschaft. Weinheim 1992, S. 25-70.
Dörrich, Sabine: Die Zukunft des Mediums Buch. Eine Strukturanalyse des verbreitenden Buchhandels. Bochum 1991.
Duclaud, Jutta / Riese, Reimar / Strauß, Gerda (Hg.): Leser und Lesen in Gegenwart und Zukunft. Leipzig 1990.
Eckhardt, Josef / Horn, Imme: Ältere Menschen und Medien. Eine Studie der ARD/ZDF-Medienkommission. Frankfurt a.M. 1988 (= Schriftenreihe MEDIA PERSPEKTIVEN, hg. v. Klaus Berg und Marie-Luise Kiefer, Bd. 8).
Eckhardt, Josef / Horn, Imme: Ältere Menschen und Medien. Frankfurt a. M. 1988.
Eckhardt, Josef: Fallstudien zum Fernsehnutzungsverhalten älterer Menschen. In: MEDIA PERSPEKTIVEN, 9/1988, S. 569-575.
Eggert, Hartmut / Garbe, Christine: Literarische Sozialisation. Stuttgart 1995.
Ehmer, Josef: Sozialgeschichte des Alters. Frankfurt a.M. 1990.
Ermert, Karl: Briefsorten. Untersuchungen zu Theorie und Empirie der Textklassifikation. Tübingen 1979 (RGL 20).
Ettl, Susanne: Anleitungen zur schriftlichen Kommunikation. Briefsteller von 1880 bis 1980. Tübingen 1984 (RGL 50).
Fabian, Thomas: Fernsehen und Einsamkeit im Alter. Eine empirische Untersuchung zu parasozialer Interaktion. Münster/Hamburg 1993 (= Fortschritte der Psychologie, Bd. 7).
Fabian, Thomas: Fernsehnutzung und Alltagsbewältigung älterer Menschen. In: Straka, Gerald A. / Fabian, Thomas / Will, Jörg (Hg.): Aktive Mediennutzung im Alter. Modelle und Erfahrung aus der Medienarbeit mit älteren Menschen. Heidelberg 1990, S. 65-75.
Fiehler, Reinhard / Thimm, Caja (Hgg.): Sprache und Kommunikation im Alter. Radolfzell 2003.
Flaig, Berthold Bodo / Meyer, Thomas / Ueltzhöffer, Jörg: Alltagsästhetik und politische Kultur. Zur ästhetischen Dimension politischer Bildung und politischer Kommunikation. 3. Aufl. Bonn 1997.
Franzmann, Bodo u. a. (Hg.): Handbuch Lesen. München 1999.
Franzmann, Bodo: Leseverhalten in Deutschland – Erwachsene und Jugendliche im Vergleich. In: Franz, Kurt / Payrhuber, Franz-Josef (Hg.): Lesen heute – Leseverhalten von Kindern und Jugendlichen und Leseförderung im Kontext der PISA-Studie. Baltmannsweiler 2002. S. 26-40.
Fritz, Angela / Suess, Alexandra: Lesen. Die Bedeutung der Kulturtechnik Lesen für den gesellschaftlichen Kommunikationsprozeß. Konstanz 1986 (= Schriften der Deutschen Gesellschaft für COMNET international Network of Centres for Documentation on Communication Research and Policies, hg. v. Otto B. Roegele und Waker J. Schütz, Bd. 6).
Fritz, Angela: Lesen in der Mediengesellschaft. Standortbeschreibung einer Kulturtechnik. Wien 1989.
Fröhner, Rolf: Das Buch in der Gegenwart. Eine empirisch-sozialwissenschaftliche Untersuchung. Gütersloh 1961.
Geißler, Rainer: Sozialstruktur und gesellschaftlicher Wandel. In: Korte/Weidenfeld 2001, S. 97-135.
Giese, Heinz W. / Januschek, Franz: Das Sprechen, das Schreiben und die Eingabe. Spekulationen über Entwicklungstendenzen von Kommunikationskultur. In: Weingarten, Rüdiger (Hg.): Information ohne Kommunikation? Frankfurt/Main 1990, 54-74.
Giesenfeld, Günter / Prugger, Prisca: Serien im Vorabend- und im Hauptprogramm. In: Schanze/Zimmermann 1994, S. 349-388.
Gluchowski, Peter: Freizeit und Lebensstile. Plädoyer für eine integrierte Analyse von Freizeitverhalten. Erkrath 1988.
Grimberg, Martin: Untersuchungen zum Verlust der Schriftsprachlichkeit. Entstehungsgeschichte, -bedingungen und Einflußfaktoren einer allgemeinen Literalität unter besonderer Berücksichtigung der schriftlich fixierten privaten Kommunikation. Frankfurt/Main u.a. 1988.
Grimm, Gunter [E.]: Rezeptionsgeschichte. Grundlegung einer Theorie. Mit Analysen und Bibliographien. München 1977.
Groeben, Norbert (Hg.): Lesesozialisation in der Mediengesellschaft. Tübingen 1999.
Groeben, Norbert / Hurrelmann, Bettina (Hg.): Lesekompetenz – Bedingungen, Dimensionen, Funktionen. Weinheim u. München 2002.
Groeben, Norbert / Vorderer, Peter: Leserpsychologie II: Lesemotivation – Lektürewirkung. Münster 1988.
Grosse, Siegfried (Hg.): „Denn das Schreiben gehört nicht zu meiner täglichen Beschäftigung“. Der Alltag kleiner Leute in Bittschriften, Briefen und Berichten aus dem 19. Jahrhundert. Ein Lesebuch. Bonn 1989.
Grosse, Siegfried (Hg.): Schriftsprachlichkeit. Düsseldorf 1983 (Sprache der Gegenwart 59).
Günther, Hartmut / Ludwig, Otto (Hgg.): Schrift und Schriftlichkeit. Ein interdisziplinäres Handbuch internationaler Forschung. Berlin / New York 1996 (HSK 10.1 / 10.2).
Günther, Klaus Burkhard / Günther, Hartmut (Hgg.): Schrift, Schreiben, Schriftlichkeit. Arbeiten zur Struktur, Funktion und Entwicklung schriftlicher Sprache. Tübingen 1983 (RGL 49).
Häcki Buhofer, Annelies: Schriftlichkeit im Alltag. Theoretische und empirische Aspekte – am Beispiel eines Schweizer Industriebetriebes. Bern u. a. 1985 (Zürcher Germanistische Studien 2).
Hagestad, Gunhild O.: Familien in einer alternden Gesellschaft: Veränderte Strukturen und Beziehungen. In: Baltes, Margret M. / Kohli, Martin / Sames, Klaus (Hg.): Erfolgreiches Altern - Bedingungen und Variationen. Bern / Stuttgart / Toronto 1989, S. 42-46.
Hallenberger, Gerd: Vorläufige Thesen zur Programmgeschichte von Quiz und Game Show im bundesdeutschen Fernsehen. In: Kreuzer/Schanze 1991, S. 153-163.
Hanebutt-Benz, Eva-Maria: Die Kunst des Lesens. Lesemöbel und Leseverhalten vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Frankfurt a. M. 1985.
Harmgarth, Friederike: Das Lesebarometer. Lesen und Umgang mit Büchern in Deutschland. Gütersloh 1999.
Hättenschwiler, Walter: Medien im Leben der Senioren. In: Medienwissenschaft Schweiz. Science Des Mass Media Suisse. Thema: „Alt und Jung in den Medien“, 1/1992, S. 43-48.
Hillard, Gustav: Vom Wandel und Verfall des Briefes. In: Merkur 23 (1969), 342-351.
Hofmann, Michael / Rink, Dieter: Milieukonzepte zwischen Sozialstrukturanalyse und Lebensstilforschung. Eine Problematisierung. In: Schwenk 1996, S. 183-199.
Horn, Imme / Eckhardt, Josef: Ältere Menschen und Medien in der Bundesrepublik Deutschland. In:
Horn, Imme: Ältere Menschen und die Massenmedien. In: Straka, Gerald/Fabian, Thomas /Will, Jörg (Hg.): Aktive Mediennutzung im Alter. Modelle und Erfahrungen aus der Medienarbeit mit älteren Menschen. Heidelberg 1990, S. 55-64.
Horton, Donald / Wohl, R. Richard: Mass Communication and Para-social Interaction: Observations on Intimacy at a Distance. In: Gumpert, Gary / Cathcart, Robert: Inter/Media. Interpersonal Communication in a Media World. New York/Oxford l986.
Hradil, Stefan: Sozialstruktur und Kultur. Fragen und Antworten zu einem schwierigen Verhältnis. In: Schwenk 1996, S. 13-30.
Hurrelmann, Bettina / Hammer, Michael / Nieß, Ferdinand (Hg.): Leseklima in der Familie. Gütersloh 1993.
Jäckel, Michael / Winterhoff-Spurk, Peter (Hg.): Mediale Klassengesellschaft? Politische und soziale Folgen der Medienentwicklung. München 1996.
Jürgens, Hans W.: Ältere Menschen in deutschen TV-Sendungen. Zerr- oder Spiegelbilder? In: medien + erziehung, 40, 5/1996, S. 267-270.
Jürgens, Hans W.: Wir und die Anderen. Vorstellungen und Fakten zum Bild des alten Menschen in unserer Gesellschaft. In: Europäisches Forum Alpbach. Verlag des Österreichischen Colleges. Wien 1994.
Kemper, Susan / S. J. Rash: Speech and Writing Across the Life-Span. In: Gruneberg, M. M. et al. (eds.): Practical Aspects of Memory: Current Research and Issues. Vol 2: Clinical and Educational implications. Chichester 1988, 107-192.
Keseling, Gisbert: Die Einsamkeit des Schreibers. Wie Schreibblockaden entstehen und erfolgreich bearbeitet werden können. Wiesbaden 2004.
Klingler, Walter (Hg.): Fernsehforschung in Deutschland. Themen – Akteure – Methoden. Bd. I. Baden-Baden 1998.
Koch, Helmut H. / Pielow, Winfried: Schreiben und Alltagskultur. Voraussetzungen und Haltungen des Schreibens in Schule, Hochschule und in außerschulischen Bereichen. Baltmannsweiler 1984.
Koch, Peter / Oesterreicher, Wulf: Schriftlichkeit und Sprache. In: Günther, Hartmut / Ludwig, Otto (Hgg.): Schrift und Schriftlichkeit. Ein interdisziplinäres Handbuch internationaler Forschung. Berlin / New York 1996 (HSK 10.1), 587-604.
Köcher, Renate: Familie und Lesen. Eine Untersuchung über den Einfluß des Elternhauses auf das Leseverhalten. In: Bundesminister für Bildung und Wissenschaft (Hg.), In Sachen Lesekultur, Bonn 1991, S. 103-115.
Kohrt, Manfred / Kucharczik, Kerstin: ‚Sprache’ – unter besonderer Berücksichtigung von ‚Jugend’ und ‚Alter’. In: Fiehler, Reinhard / Thimm, Caja (Hg.): Sprache und Kommunikation im Alter. Radolfzell 2003, 17-37.
Kohrt, Manfred: Zur neueren ‚Schriftlichkeitsforschung‘. In: Leuvense Bijdragen 83 (1994), 301-315.
Konrad, Helmut (Hg.): Der alte Mensch in der Geschichte. Wien 1982.
Korte, Karl-Rudolf / Weidenfeld, Werner (Hg.): Deutschland-TrendBuch. Fakten und Orientierungen. Opladen 2001.
Kreuzer, Helmut / Schanze, Helmut (Hgg.): Fernsehen in der Bundesrepublik Deutschland. Perioden – Zäsuren – Epochen. Heidelberg 1991.
Krotz, Friedrich: Lebensstile, Lebenswelten und Medien: Zur Theorie und Empirie individuenbezogener Forschungsansätze des Mediengebrauchs. In: Rundfunk und Fernsehen 39 (1991), 317-342.
Kübler, Hans-Dieter / Burkhardt, Wolfgang / Graf, Angela (Hg.):Ältere Menschen und neue Medien. Eine Rezeptionsstudie zum Medienverhalten und zur Medienkompetenz älterer Menschen in Hamburg und Umgebung. Berlin 1991 (= Schriftenreihe der Hamburgischen Anstalt für neue Medien HAM, hg. v. der HAM, Bd. 4).
Kübler, Hans-Dieter / Burkhardt, Wolfgang: Ältere Menschen: Im Abseits der neuen Medien? Eine Rezeptionsstudie zum Medienverhalten und Medienkompetenz älterer Menschen in Hamburg und Umgebung. In: Communications, 17/1992, 3,S. 331-363.
Kübler, Hans-Dieter: Ende der Schriftkultur? Anmerkungen zu einem wissenschaftlichen Modethema. In: Wirkendes Wort 35 (1985), 338-362.
Langen, Claudia / Bentlage, Ulrike (Hgg.): Das Lesebarometer – Lesen und Mediennutzung in Deutschland. Gütersloh 2000.
Lehr, Ursula / Schmitz-Scherzer, Reinhard / Quadt, Else: Weiterbildung im höheren Erwachsenenalter. Stuttgart / Berlin / Köln / Mainz 1979 (= Schriftenreihe des Bundesministers für Jugend, Familie und Gesundheit, Bd. 65).
Lehr, Ursula / Thomae, Hans, Psychologie des Alterns. Heidelberg/Wiesbaden 7. Aufl. 1991.
Lehr, Ursula: Psychologische Aspekte des Alterns. In: Reimann, Helga / Reimann, Horst (Hg.): Das
Leidhold, Wolfgang: Wissensgesellschaft. In: Korte/Weidenfeld 2001, S. 429-460.
Lintas Deutschland: Einstellung der Bevölkerung zum Briefeschreiben. Hamburg 1979.
Löwe, Hans: Einführung in die Lernpsychologie des Erwachsenenalters. Berlin 1976.
Lüdtke, Hartmut: Expressive Ungleichheit. Zur Soziologie der Lebensstile. Opladen 1989.
Maase, Kaspar: Grenzenloses Vergnügen. Der Aufstieg der Massenkultur 1850-1970. Frankfurt a. M. 1997.
Maase, Kaspar: Leseinteressen der Arbeiter in der BRD. Über Leseverhalten, Lektüreinteressen und Bedürfnisentwicklung in der Arbeiterklasse der Bundesrepublik. Köln 1975.
Martino, Alberto: Die deutsche Leihbibliothek. Geschichte einer literarischen Institution (1756-1914). Mit einem zusammen mit Georg Jäger erstellten Verzeichnis der erhaltenen Leihbibliothekskataloge. Wiesbaden 1990.
Mayer, Karl U. / Baltes, Paul B. (Hg.): Die Berliner Altersstudie. Berlin 1996 (= Ein Projekt der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Interdisziplinäre Arbeitsgruppen. Forschungsberichte, Bd. 3).
Meier, Jörg: www.buch.ade? Schrift- und Lesekultur in Zeiten des Internet. In: J. M. / Ziegler, Arne (Hg.): Edition und Internet. Berlin 2004. S. 11-41.
Meyen, Michael: Mediennutzung. Mediaforschung, Medienfunktionen, Nutzungsmuster. Konstanz 2001.
Michailow, Matthias: Lebensstilsemantik. Soziale Ungleichheit und Formationsbildung in der Kulturgesellschaft. In: Mörth/Fröhlich 1994, S. 107-128.
Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (Hg.): Ältere Menschen in Nordrhein-Westfalen. Wissenschaftliches Gutachten zur Lage der älteren Menschen und zur Altenpolitik in Nordrhein-Westfalen zur Vorbereitung des Zweiten Landesaltenplans. Düsseldorf 1989.
Moers, Martha: Die beiden Altersformen. In: Thomae, Hans/Lehr, Ursula (Hg.): Altern. Wiesbaden 1977 ,S. 135-141.
Molitor, Petra: „Der Fernsehzuschauer durch die sozio-kulturelle Brille“: Lebensstiltypologien in der Fernsehzuschauerforschung am Beispiel der Sinus-Milieus im AGF/GfK-Fernsehpanel. Unveröff. Magisterarbeit. U Mainz (Fachbereich Sozialwissenschaften) 2001.
Mollenkopf, Heidrun / Doh, Michael: Das Medienverhalten älterer Menschen. In: Sozialwissenschaften und Berufspraxis, 4/2002. (Themenschwerpunkt Virtualisierung des Sozialen), S. 387-408.
Moritz, Rainer: Der Schlager. In: François, Etienne / Schulze, Hagen (Hg.): Deutsche Erinnerungsorte. Bd. 3. München 2001. S. 201-218 u. 703f.
Mörth, Ingo / Fröhlich, Gerhard (Hgg.): Das symbolische Kapital der Lebensstile. Zur Kultursoziologie der Moderne nach Pierre Bourdieu. Frankfurt a. M. u. New York 1994.
Mörth, Ingo / Fröhlich, Gerhard: Lebensstile als symbolisches Kapital? Zum aktuellen Stellenwert kultureller Distinktionen. In: Mörth/Fröhlich 1994, S. 7-30 [= 1994a].
Munnichs, Joep M. A. / Nies, Henk (Hg.): Sinngebung und Altern. Berlin 3. Aufl. 1992 (= Beiträge zur Gerontologie und Altenarbeit, hg. vom Deutschen Zentrum für Altersfragen DZA, Bd. 66).
Naegele, Gerhard / Tews, Hans Peter (Hg.): Lebenslagen im Strukturwandel des Alters. Alternde Gesellschaft - Folgen für die Politik. Opladen 1993.
Nusser, Peter: Unterhaltung und Aufklärung. Studien zur Theorie, Geschichte und Didaktik der populären Lesestoffe. Frankfurt a. M. u. a. 2000.
Nutz, Walter: Trivialliteratur und Popularkultur. Vom Heftromanleser zum Fernsehzuschauer. Eine literatursoziologische Analyse unter Einschluß der Trivialliteratur der DDR. Unter Mitarbeit von Katharina Genau und Volker Schlögell. Opladen u. Wiesbaden 1999.
Opaschowski, Horst: Einführung in die Freizeitwissenschaft. 3. Aufl. Opladen 1997.
Peiser, Wolfram: Die Fernsehgeneration. Eine empirische Untersuchung ihrer Mediennutzung und Medienbewertung. Opladen 1996.
Polenz, Peter v.: Deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart. Band III: 19. und 20. Jahrhundert. Berlin / New York 1999.
Prahl, Hans-Werner / Schroeter, Klaus, Die Soziologie des Alterns, Frankfurt a.M. 1996.
Raumer-Mandel, Alexandra: Medien-Lebensläufe von Hausfrauen. Eine biographische Befragung, München 1990.
Reimann, Helga / Reimann, Horst (Hg.): Das Alter. Einführung in die Gerontologie. Stuttgart 1994.
Reimann, Horst: Interaktion und Kommunikation im Alter. In: Reimann, Helga / Reimann, Horst (Hg.): Das Alter. Einführung in die Gerontologie. Stuttgart l994, S. 109-139.
Rogge, Jan Uwe: Ältere Menschen, Altern und die subjektive Bedeutung von Medien - Schlaglichter auf ein komplexes Beziehungsgeflecht. In: Gottwald, Ekkart / Hibbeln, Regina / Lauffer, Jürgen (Hg.): Alte Gesellschaft - Neue Medien. Opladen 1989,S. 147-167.
Rogge, Jan Uwe: Medien und Alter - eine Sichtung der Forschungsliteratur. In: medien + erziehung, 35, 2/1991, S. 81-87.
Rosebrock, Cornelia (Hg.): Lesen im Medienzeitalter. Weinheim u. München 1995.
Rosenbaum, Heidi: Formen der Familie. Untersuchungen zum Zusammenhang von Familienverhältnissen, Sozialstruktur und sozialem Wandel in der deutschen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts. Frankfurt a. M. 1982.
Rosenmayr, Leopold: Die Kräfte des Alters. Wien 1990.
Rupp, Gerhard / Heyer, Petra / Bonholt, Helge: Lesen und Medienkonsum. Wie Jugendliche den Deutschunterricht verarbeiten. Weinheim u.a. 2004.
Saxer, Ulrich / Landolt, Marianne: Medien – Lebensstile. Lebensstilmodelle von Medien für die Freizeit. Zürich 1995.
Schanze, Helmut (Hg.): Handbuch der Mediengeschichte. Stuttgart 2001.
Schanze, Helmut / Zimmermann, Bernhard (Hg.): Das Fernsehen und die Künste (= Kreuzer, Helmut / Thomsen, Christian W. (Hg.): Geschichte des Fernsehens in der Bundesrepublik Deutschland. Bd. 2). München 1994.
Scharioth, Joachim: Das Lesen alter Menschen. Eine empirische Untersuchung über das Bücherlesen in Hamburg. Hamburg 1969 ( Berichte des Instituts für Buchmarkt-Forschung, Sondernummer).
Schikorsky, Isa: Private Schriftlichkeit im 19. Jahrhundert. Untersuchungen zur Geschichte des alltäglichen Sprachverhaltens ‚kleiner Leute‘. Tübingen 1990 (RGL 107).
Schmitz, Claudius A. / Kölzer, Brigitte: Einkaufsverhalten im Handel. Ansätze zu einer kundenorientierten Handelsmarketingplanung. München 1996.
Schneider, Jost: Psychische Globalisierung? Vom Projekt einer Weltliteratur zur Realität der Weltunterhaltungskultur. In: Trans. Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften (Wien) 2003 [2004], H. 15. [URL: www.inst.at/trans/15Nr/04_08/schneider15.htm]
Schneider, Jost: Sozialgeschichte des Lesens. Zur historischen Entwicklung und sozialen Differenzierung der literarischen Kommunikation in Deutschland. Berlin u. New York: Walter de Gruyter 2004. 483 S., 36 Abb.
Scholz, Günther: Die Angestellten seit dem 19. Jahrhundert. München 2000.
Schön, Erich: Der Verlust der Sinnlichkeit oder die Verwandlungen des Lesers. Mentalitätswandel um 1800. Stuttgart 1987.
Schön, Erich: Geschichte des Lesens. In: Franzmann u. a. 1999, S. 1-85.
Schön, Erich: Lesen und Medien im Alter. In: InitiativForum Generationenvertrag (H.): Altern ist anders. Münster: LIT Verlag 2004 (= ALTERnativen. Schriftenreihe des InitiativForum Generationenvertrag (IFG) an der Universität zu Köln, Bd. 1), S. 48-74.
Schulze, Barbara: Kommunikation im Alter. Theorien – Studien – Forschungsperspektiven. Opladen 1998 (Studien zur Kommunikationswissenschaft 39).
Schwenk, Otto G. (Hg.): Lebensstil zwischen Sozialstrukturanalyse und Kulturwissenschaft. Opladen 1996.
Sieber, Peter: Parlando in Texten. Zur Veränderung kommunikativer Grundmuster in der Schriftlichkeit. Tübingen 1998 (RGL 191).
Sieder, Reinhard: Sozialgeschichte der Familie. Frankfurt a. M. 1987.
SINUS – Sozialwissenschaftliches Institut Nowak und Partner: Die Sinus-Milieus. Kurzinformation. Heidelberg 1999.
SINUS Sociovision: Die Sinus-Milieus im Fernsehpanel. Hg. von der AGF – Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung. O.O. 2000.
Sirat, Colette et al.: Writing and Reading in Time and Culture. In: Writing development: An interdisciplinary view. Ed. by C. Pontecorvo. Amsterdam 1997, 99-189.
SPIEGEL-Dokumentation: OUTFIT 3. Hg. v. SPIEGEL-Verlag. Hamburg 1994.
Steger, Hugo: Sprachgeschichte als Geschichte der Textsorten, Kommunikationsbereiche und Semantiktypen. In: Besch, Werner et al. (Hgg.): Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung. 2., veränderte u. erweiterte Auflage. 1. Teilband. Berlin / New York 1998 (HSK 2.1), 284–300.
Steinack, Regina: Ältere Menschen in der Bundesrepublik Deutschland: Grunddaten, Lebensbereiche, Bedürfnisse, Angebote und Dienste. In: Dieck, Margret/Steinack, Regina: Gesellschaftliche Integration, soziale Interaktion. Materielle und immaterielle Ressourcen: Aspekte der Situation älterer Menschen in der Bundesrepublik Deutschland, hg. von der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen/European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions Dublin sowie vom Deutschen Zentrums für Altersfragen eV., Berlin) Berlin (West)/Dublin 1987, 5. 203-282.
Stiftung Lesen (Hg.): Gutenbergs Folgen – Von der ersten Medienrevolution zur Wissensgesellschaft. Baden-Baden 2002.
Stiftung Lesen (Hg.): Lesen. Zahlen, Daten, Fakten über Bücher, Zeitungen, Zeitschriften und ihre Leser. Mainz 2. Aufl. 1991.
Stiftung Lesen (Hg.): Leseverhalten in Deutschland 1992/93. Repräsentativstudie zum Lese- und Medienverhalten der erwachsenen Bevölkerung im vereinigten Deutschland. Mainz 1993.
Stiftung Lesen (Hg.): Leseverhalten in Deutschland im neuen Jahrtausend. Mainz u. Hamburg 2001.
Stocker, Günther: ‘Lesen’ als Thema der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts. Ein Forschungsbericht. In: Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur 27 (2002), H. 2, S. 208-241.
Straka, Gerald A. / Fabian, Thomas / Nolte, Heike / Will, Jörg: Ältere Menschen und der Wandel der Medienlandschaft in Dortmund. Ergebnisse einer empirischen Untersuchung zur Rolle des Kabelfernsehens und anderer Massenmedien im Alltag älterer Menschen. Bremen 1988.
Straka, Gerald A. / Fabian, Thomas / Will, Jörg (Hg.): Aktive Mediennutzung im Alter. Modelle und Erfahrungen aus der Medienarbeit mit älteren Menschen. Heidelberg 1990.
Straka, Gerald A. / Fabian, Thomas / Will, Jörg: Medien im Alltag älterer Menschen. Düsseldorf 1989 (= Begleitforschung des Landes Nordrhein-Westfalen zum Kabelpilotprojekt Dortmund, hg. vom Presse- und Informationsamt der Landesregierung Nordrhein-Westfalen, Bd. 18).
Tews, Hans Peter: Alter und Altern in unserer Gesellschaft. In: Reimann, Helga / Reimann, Horst (Hg.): Das Alter. Einführung in die Gerontologie. Stuttgart l994, S. 30-74.
Tews, Hans Peter: Altersbilder. Über Wandel und Beeinflussung von Vorstellungen vom und Einstellungen zum Alter. Köln 1991 (= KDA-Schriftenreihe FORUM, hg. vom Kuratorium Deutsche Altershilfe KDA, Bd. 16).
Thimm, Caja: Alter – Sprache – Geschlecht. Sprach- und kommunikationswissenschaftliche Perspektiven auf das höhere Lebensalter. Frankfurt / New York 2000.
Thomas, Rüdiger: Kultur und Gesellschaft. In: Korte/Weidenfeld 2001, S. 461-512.
Titius, Jürgen: Erfolgsmessung der Werbekampagne „Schreib mal wieder“. In: Archiv für das Post- und Fernmeldewesen. Zeitschrift für Rechts-, Verwaltungs- und Verkehrswissenschaft der Deutschen Bundespost 36 (1984), 14-22.
TNS Emnid: (N)ONLINER Atlas 2004. [URL: http://www.nonliner-atlas.de/pdf/NONLINER-Atlas2004_TNS_Emnid_InitiativeD21.pdf]
Vester, Heinz-Günter: Zeitalter der Freizeit. Eine soziologische Bestandsaufnahme. Darmstadt 1988.
Vester, Michael / Oertzen, Peter von / Geiling, Heiko / Hermann, Thomas / Müller, Dagmar: Neue soziale Milieus und pluralisierte Klassengesellschaft. Endbericht des Forschungsprojektes ‘Der Wandel der Sozialstruktur und die Entstehung neuer gesellschaftlich-politischer Milieus’. Hannover 1992.
Vester, Michael: Die verwandelte Klassengesellschaft. Modernisierung der Sozialstruktur und Wandel der Mentalitäten in Westdeutschland. In: Mörth/Fröhlich 1994, S. 129-166.
Vester, Michael: Milieus und soziale Gerechtigkeit. In: Korte/Weidenfeld 2001, S. 136-183.
Vester, Michael: Soziale Milieus im gesellschaftlichen Strukturwandel. Zwischen Integration und Ausgrenzung. Köln 1993.
Vorderer, Peter (Hg.): Fernsehen als „Beziehungskiste“: Parasoziale Beziehungen und Interaktionen mit TV-Personen. Opladen 1996.
Wagner, Michael / Schütze, Yvonne / Lang, Frieder R.: Soziale Beziehungen alter Menschen. In: Mayer, Karl U. / Baltes, Paul B. (Hrsg.): Die Berliner Altersstudie. Ein Projekt der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Interdisziplinäre Arbeitsgruppen. Forschungsberichte, Bd. 3, Berlin 1996, S. 302-319.
Wieler, Petra: Vorlesen in der Familie – Fallstudien zur literarisch-kulturellen Sozialisation von Vierjährigen. Weinheim u. München 1997.
Wild, Reiner (Hg.): Geschichte der deutschen Kinder- und Jugendliteratur. 2., erg. Aufl. Stuttgart u. Weimar 2002.
Wilke, Jürgen (Hg.): Mediengeschichte der Bundesrepublik Deutschland. Köln, Weimar u. Wien 1999.
Wilke, Jürgen: Grundzüge der Medien- und Kommunikationsgeschichte. Von den Anfängen bis ins 20. Jahrhundert. Köln, Weimar u. Wien 2000.
Winckler, Lutz: Autor – Markt – Publikum. Zur Geschichte der Literaturproduktion in Deutschland. Berlin 1986.
Wittmann, Reinhard: Geschichte des deutschen Buchhandels. Ein Überblick. München 1991.
Wyss, Eva Lia: Liebesbriefe von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Eine Textsorte im lebenszeitlichen Wandel. In: Annelies Häcki Buhofer (Hg.): Spracherwerb und Lebensalter. Unter Mitarbeit von Lorenz Hofer u.a. Tübingen/Basel 2003 (Basler Studien zur deutschen Sprache und Literatur 83), 71-86.